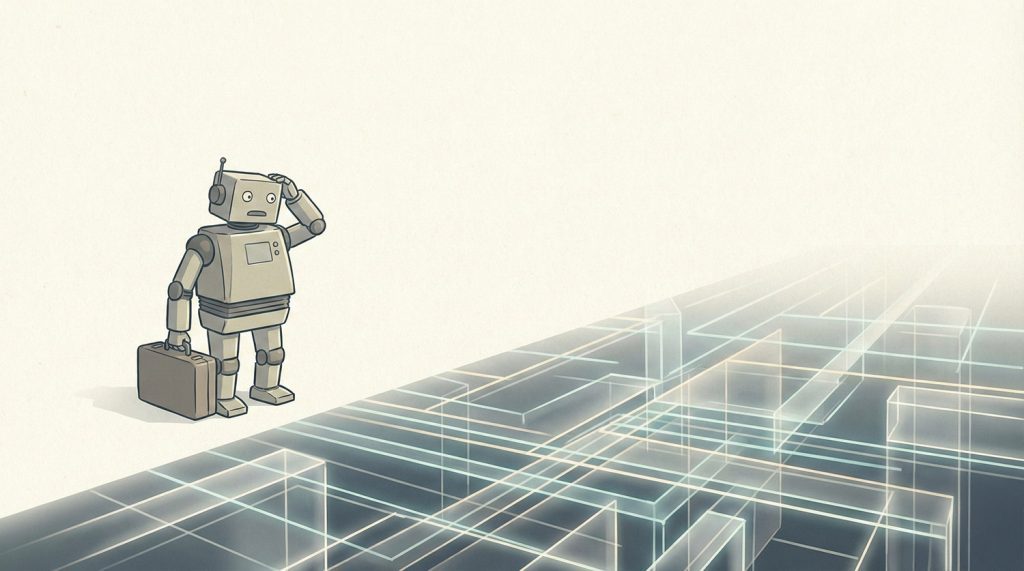Die Suche, wie wir sie kennen, stirbt – und mit ihr das vertraute Prinzip, Wissen durch Klicken und Vergleichen zu entdecken.
Mit dem Google AI Mode antwortet nicht mehr das Web, sondern ein Sprachmodell – direkt, dialogisch und allgegenwärtig.
Damit wird jede Google-Anfrage zur Interaktion mit einer Künstlichen Intelligenz, die unter den EU AI Act fällt.
Was für Tech-Nerds schon Alltag war, betrifft nun alle Mitarbeitenden, Lehrenden und Konsumierenden:
Jede Recherche, jede Entscheidung, jede Information läuft künftig durch ein generatives Modell.
Das verändert nicht nur SEO und Medienlandschaft – es verändert, wie wir Wissen, Wahrheit und Verantwortung verstehen und erfordert KI-Kompetenz.
- Google AI Mode: Ein neuer Suchmodus auf Basis von Gemini 2.5 Pro ersetzt klassische Linklisten durch generative Antworten und dialogische Interaktion.
- Zero-Click Search: Nutzer bleiben in der KI-Antwort – laut Studien sinken Klickzahlen auf Websites um bis zu 35 %. Für SEO, Publisher und Verlage beginnt eine neue Ära.
- EU AI Act greift erstmals alltagsnah: Weil jede Google-Suche nun mit einem LLM interagiert, gelten Transparenz-, Schulungs- und Kontrollpflichten auch für Unternehmen, Bildung und Verwaltung.
- KI-Kompetenz wird Pflicht: Faktische und emotionale Medienkompetenz werden zur Grundvoraussetzung – Faktenprüfung ersetzt klassisches Link-Klicken.
- Emotionale Bindung an Chatbots: Studien zeigen wachsende Vertrauens- und Abhängigkeitsmuster – kritisches Denken wird zur digitalen Resilienz.
- Gesellschaftliche Dimension: Der AI Mode verändert, wie wir Wissen, Wahrheit und Verantwortung verstehen – ein Wendepunkt für Wirtschaft, Bildung und Demokratie.
Was ist der Google AI Mode?
Der Google AI Mode ist ein eigener Suchmodus, der klassische Linklisten durch
generative, dialogische Antworten ersetzt. Technisch stützt er sich auf das
Gemini-Modell (u. a. 2.5 Pro) und kombiniert Suche mit
Reasoning und Quellenaggregation. Für besonders komplexe Fragen bietet Google
zusätzlich Deep Search an: ein in den AI Mode integriertes Recherche-Feature,
das „hunderte Websites“ automatisch durchsucht und daraus einen zitierten Report erstellt
(Google, 2025a; Google, 2025b).
Funktionsprinzip in Kurzform
- Fan-out & RAG: Nutzerfragen werden in Teilfragen zerlegt, parallel recherchiert
und mithilfe von Retrieval-Augmented Generation zu einer konsolidierten Antwort verbunden
(Google, 2025a). - Multimodalität: Neben Text verarbeitet der Modus auch Bilder/ Kameraeingaben (Lens-Integration)
und Stimme; visuelle „Such-Fan-outs“ ergänzen die Textsuche (TechRadar, 2025). - Deep Search: Für Tiefenrecherchen erstellt Gemini 2.5 Pro voll zitierte, mehrseitige
Zusammenfassungen in wenigen Minuten (Google, 2025a; Google, 2025b). - Agentische Fähigkeiten (im Ausbau): Gemini 2.5 entwickelt sich Richtung
„Computer Use“ (z. B. Browser-/App-Steuerung für Aufgaben) – ein Hinweis, dass
Suche und Handlung zunehmend verschmelzen (heise, 2025).
Worin sich der AI Mode von der klassischen Suche unterscheidet
Während die klassische Suche Ergebnisse liefert, präsentiert der AI Mode eine
Antwort – kuratiert, strukturiert und (idealiter) mit Quellen. Nutzer:innen interagieren
dialogisch, stellen Rückfragen und bleiben häufiger im AI-Interface. Erste Studien zu
AI Overviews (dem Vorläuferprinzip) zeigen bereits, dass die Klickrate auf organische
Resultate deutlich sinkt (Ahrefs, 2025; Search Engine Land, 2025). Für Unternehmen, Publisher
und SEO bedeutet das: Sichtbarkeit entsteht nicht mehr nur in den Top-10-Links, sondern
in der Antwort selbst.
Warum dieser Modus ein Wendepunkt ist
Mit dem AI Mode interagieren faktisch alle, die Google nutzen, mit einem
LLM – nicht nur Tech-Frühaufsteher:innen. Damit werden Anforderungen des
EU AI Act (Transparenz, Dokumentation, Schulungen) plötzlich alltagsrelevant
für Organisationen: von KMU über Schulen bis hin zu Behörden. Zugleich verschiebt sich
Verantwortung: Faktenprüfung und KI-Kompetenz werden zur Grundbedingung,
weil das gewohnte „Link-Klicken und Vergleichen“ in vielen Journey-Schritten entfällt
(Google, 2025a; Ahrefs, 2025).
von der Ergebnisliste zur dialogischen Antwort, von SEO zu „GEO“ (von der
Search Engine Optimization zur Generative Engine Optimization) – mit
direkten Folgen für Sichtbarkeit, Compliance und Kompetenzen.
Was das für Nutzer:innen sofort bedeutet
- Schneller zum Ergebnis: Antworten statt Linklisten, inklusive strukturierter
Handlungsvorschläge und Verweise (Google, 2025a). - Weniger Klicks, mehr Vertrauen nötig: Die Abhängigkeit von der KI-Zusammenfassung
steigt – kritisches Lesen und Faktencheck werden zur Sicherungsschicht
(Ahrefs, 2025). - Visuelle & gesprochene Interaktionen: Bilder/ Kamera und Voice ergänzen die
Recherche – hilfreich, aber potenziell bias-anfällig (TechRadar, 2025). - Nächster Schritt: „Computer Use“ – die KI führt Aufgaben im Browser/App aus;
das verschiebt den Fokus von Informationen hin zu Aktionen (heise, 2025).
Wie der AI Mode die klassische Suche verändert
Der Google AI Mode markiert nicht nur eine technische Evolution, sondern eine
kulturelle Zäsur im Informationsverhalten. Während bisher das Ziel jeder Suchmaschine
darin bestand, Nutzer:innen zu externen Quellen zu führen, hält der AI Mode sie im
Antwort-Interface. Das verändert nicht nur Klickpfade, sondern das
gesamte Ökosystem von Reichweite, Vertrauen und ökonomischer Wertschöpfung
(Ahrefs, 2025; Pew Research Center, 2025).
Rückgang klassischer Klicks – die „Zero-Click Search“
Studien belegen, dass bereits bei den früheren AI Overviews die Klickrate
auf organische Ergebnisse um durchschnittlich 34,5 % sank
(Ahrefs, 2025). Eine Pew-Analyse aus 2025 ergab, dass nur 8 % der
Nutzer:innen nach einer KI-Antwort noch klassische Suchergebnisse aufrufen
(Pew Research Center, 2025). Eine interne Auswertung von
Growth Memo zeigt, dass 77 % der Suchenden vollständig im
AI-Panel verbleiben – ein klarer Hinweis auf den Übergang zur
Zero-Click Search.
Konsequenz für Publisher und SEO:
Antwort-Korpus spielt, verliert Sichtbarkeit – auch bei perfektem
Keyword-Ranking. Damit verschiebt sich der Wettbewerb von der
Position 1 im Ranking hin zur Zitierung im Antworttext.
Auswirkungen auf Verlage und Publisher
Für Verlage und Content-Plattformen ist der AI Mode ein doppelter Einschnitt:
Sichtbarkeit und Monetarisierung hängen zunehmend davon ab, ob Inhalte von
Googles KI zitiert werden. Laut Branchenumfrage von Reuters Institute (2025)
verzeichnen große Publisher seit Einführung der AI-Overviews
Traffic-Rückgänge von 20 bis 30 %. Damit geraten
werbebasierte Geschäftsmodelle unter Druck.
Einige Häuser reagieren mit Lizenzpartnerschaften oder
GEO-Strategien – der gezielten Optimierung für
Generative Engine Optimization statt klassischem SEO.
Hinzu kommt ein ethisches Problem: In 92 % der vom
Gemini-Modell generierten Antworten fehlen
Quellennachweise, obwohl Informationen aus externen Seiten stammen
(Zhou et al., 2025). Diese „Attribution Crisis“ verschiebt
den Wertschöpfungsfluss – von Content-Produzenten zu Plattformbetreibern.
Für Medienhäuser ist das ein Weckruf, neue Wege der Sichtbarkeit
und Vergütung zu schaffen.
Veränderungen im Nutzerverhalten
Nutzer:innen formulieren im AI Mode längere, dialogischere Fragen.
Untersuchungen zeigen, dass Suchsitzungen zwar kürzer werden, die
Zufriedenheit mit der Antwort aber steigt (Google Insights, 2025).
Gleichzeitig nimmt das kritische Hinterfragen ab – je häufiger
Menschen generative Antworten konsumieren, desto seltener prüfen sie Fakten
selbstständig (MIT & UCL, 2025).
Der Weg vom aktiven Recherchieren zum passiven Bestätigen ist kurz – und
gesellschaftlich folgenschwer.
Von SEO zu GEO – Generative Engine Optimization
Für Unternehmen und Content-Teams entsteht eine neue Disziplin:
GEO. Sichtbar wird nicht mehr, wer den besten
Keyword-Match liefert, sondern wer inhaltlich und semantisch so
klar strukturiert ist, dass KI-Modelle den Content zuverlässig
zitieren können (Search Engine Land, 2025).
Das erfordert:
- Strukturierte Inhalte: Tabellen, Quellenangaben,
kurze Absätze und klare Signalbegriffe. - Faktenbasierte Qualität: KI-Modelle gewichten
nach Vertrauenssignalen und Präzision – nicht nur nach Popularität. - Semantische Tiefe: Themen ganzheitlich abbilden,
damit Gemini & Co. Inhalte als „kontextführend“ einstufen.
Praxis-Tipp:
erscheinen – und ob sie korrekt zitiert werden. Tools wie
Ahrefs Brand Radar oder New Distru.ai bieten erste
Einblicke in die Sichtbarkeit innerhalb generativer Suchsysteme.
Der Bruch im Informationsökosystem
Früher bestimmte Google, welche Links relevant sind – heute bestimmt
die KI, welche Antwort zählt. Damit wird ein fundamentaler Teil
des öffentlichen Informationsflusses privatisiert.
Aus Sicht der digitalen Ethik ist das ein Paradigmenwechsel:
Der Zugang zu Wissen hängt künftig von Trainingsdaten, Modellarchitektur
und Gewichtung ab – nicht mehr allein von publizierten Quellen.
Dieser Wandel verlangt neue Strategien für Transparenz,
Quellenprüfung und digitale Mündigkeit.
Warum KI-Kompetenz jetzt alle betrifft
Mit dem Start des Google AI Mode endet die Zeit, in der nur wenige Expert:innen
mit generativer KI arbeiteten. Nun interagiert fast jede Person, die Google nutzt,
direkt mit einem Large Language Model. Damit ist KI-Kompetenz
– also die Fähigkeit, KI-Ausgaben kritisch zu verstehen, zu prüfen und verantwortungsvoll zu nutzen –
keine Kür mehr, sondern eine Grundvoraussetzung digitaler Mündigkeit (European Commission, 2024).
Von „Digital Literacy“ zu „AI Literacy“
Der Begriff AI Literacy beschreibt laut Fraunhofer Academy
die Schnittmenge aus technologischem Verständnis, ethischem Bewusstsein und
Anwendungskompetenz im Umgang mit KI-Systemen (Fraunhofer Academy, 2025).
Laut einer aktuellen Bitkom-Erhebung wünschen sich 82 % der Angestellten
gezielte KI-Schulungen, aber nur ein Drittel der Unternehmen bietet diese an
(Bitkom Research, 2025).
Diese Diskrepanz zeigt: Der AI Mode zwingt Organisationen, Kompetenzaufbau nicht länger aufzuschieben.
Bildungsexpert:innen fordern, dass KI-Kompetenz in Schulen und Hochschulen denselben Stellenwert erhält
wie Sprach- oder Medienkompetenz (OECD, 2025). Denn wer nicht versteht, wie ein Sprachmodell
arbeitet, kann seine Ergebnisse kaum einordnen – und verliert schnell die Fähigkeit,
zwischen Wahrscheinlichkeit und Wahrheit zu unterscheiden.
Fakten prüfen statt blind vertrauen
„Vergleichen per Klick“. Die Verantwortung zur Faktenprüfung
wandert damit von der Suchmaschine zum Menschen.
Wer KI-Antworten nutzt, sollte mindestens zwei Originalquellen gegenchecken
und prüfen, ob Zitate, Zahlen oder Empfehlungen nachvollziehbar sind
(MIT & UCL, 2025).
Emotionale Bindung an Chatbots – eine neue Herausforderung
Eine oft unterschätzte Folge der KI-Durchdringung ist die emotionale Bindung,
die viele Menschen zu Chatbots entwickeln.
In einer MIT-Langzeitstudie mit 981 Teilnehmenden zeigten sich deutliche Korrelationen zwischen
intensiver Chatbot-Nutzung und höherem Einsamkeits- sowie Abhängigkeitsgefühl
(MIT Media Lab, 2025).
Die Forscher:innen sprechen von einer „Illusion of Intimacy“, bei der
Nutzer:innen empathische Muster auf Maschinen projizieren (Zhou & Huang, 2025).
Ähnliche Ergebnisse liefert die Studie The Rise of AI Companions
(University College London, 2025):
Je stärker Chatbots anthropomorph reagieren – also Emotionen oder persönliche Geschichten andeuten –
desto höher das wahrgenommene Vertrauen.
Paradoxerweise steigt damit auch die Gefahr, Falschaussagen zu übersehen oder
kritisches Denken zu unterdrücken.
Aus Sicht der KI-Beratung:
Je vertrauter die Interaktion wirkt, desto geringer wird die Faktenkontrolle.
KI-Kompetenz bedeutet daher nicht nur technisches Wissen,
sondern auch emotionale Distanz – die Fähigkeit, Nähe zu erleben,
ohne Urteilsfähigkeit zu verlieren.
Gesellschaftliche Verantwortung und Bildung
Wenn Informationssuche zu einer KI-gestützten Antwort-Erfahrung wird,
müssen Gesellschaft und Bildungssysteme neue Leitplanken setzen.
Medienpädagog:innen sprechen von der Notwendigkeit einer „kritischen KI-Kultur“,
die emotionale Resilienz, Faktenprüfung und ethisches Denken vereint
(European Schoolnet, 2025).
Diese Kompetenz zu fördern, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe –
vergleichbar mit der Einführung von Schulpflicht oder Datenschutz in früheren Epochen.
Denn der AI Mode bringt eine Wahrheit auf den Punkt:
Wir müssen lernen, KI zu verstehen, bevor KI uns versteht.
Nur wer kritisch prüft, behält Kontrolle über Wissen, Meinung und
letztlich über demokratische Urteilsfähigkeit.
Chancen & Strategien für Unternehmen, Bildung & Gesellschaft
Der Google AI Mode ist nicht nur Herausforderung, sondern auch Gelegenheit,
digitale Kompetenzen, Vertrauen und Innovationsfähigkeit neu zu gestalten.
Wer jetzt strategisch handelt, kann die KI-Transformation aktiv formen
– statt ihr nur zu reagieren (McKinsey, 2025).
Unternehmen: Von Compliance zu strategischer KI-Governance
Für Unternehmen ist der AI Mode ein Weckruf, KI-Governance
nicht mehr als Risikoabwehr, sondern als Wettbewerbsvorteil zu begreifen.
Laut Deloitte (2025) planen bereits 61 % der europäischen Firmen,
interne Richtlinien für generative KI einzuführen. Erfolgreiche Modelle
kombinieren drei Ebenen:
- Strukturen: Ein KI-Beauftragter oder AI Board,
das rechtliche, ethische und technische Standards überwacht. - Prozesse: Dokumentation aller KI-gestützten Entscheidungen
(z. B. Texte, Analysen, Recherchen) im Sinne des EU AI Act (Art. 9). - Kultur: Offene Lernformate und Fehlertransparenz –
damit Mitarbeitende KI als Werkzeug, nicht als Wahrheit verstehen.
das dokumentiert, wann, wie und mit welchen Tools KI-Outputs genutzt wurden.
Das erleichtert Audit-Nachweise und verbessert die Nachvollziehbarkeit
gegenüber Kund:innen und Aufsichtsbehörden (AOS Shearman, 2025).
Publisher & Medien: Qualität, Tiefe und Vertrauen als Währung
Für Publisher und Medienhäuser wird Qualität
zur einzigen nachhaltigen Währung. Da der AI Mode Inhalte extrahiert und
paraphrasiert, überleben langfristig nur Quellen mit
einzigartiger Tiefe, klarer Autorenschaft und Transparenz
(Reuters Institute, 2025).
Strategien, die sich derzeit abzeichnen:
- Lizenzpartnerschaften: Kooperationen mit KI-Anbietern
zur vergüteten Nutzung journalistischer Inhalte (Springer Nature, 2025). - GEO-optimierte Inhalte: strukturierte, faktenreiche Formate,
die von KI-Modellen als vertrauenswürdig erkannt werden (Search Engine Land, 2025). - Diversifizierung: Newsletter, Events und Communities,
um Reichweite unabhängig von Suchmaschinen aufzubauen.
sondern wer nachprüfbar richtig berichtet.
Vertrauen wird der entscheidende SEO-Faktor der Zukunft.
Bildung & öffentliche Einrichtungen: KI-Kompetenz als Allgemeinbildung
Schulen, Hochschulen und Verwaltungen spielen eine Schlüsselrolle:
Sie bilden die Grundlage für eine gesellschaftliche KI-Resilienz.
Laut European Schoolnet (2025) sollten AI-Literacy-Programme drei Ebenen abdecken:
- Verstehen: Wie arbeiten Sprachmodelle,
wo liegen ihre Grenzen? - Bewerten: Wie erkennt man Halluzinationen,
Bias oder manipulative Antworten? - Gestalten: Wie kann KI ethisch, kreativ
und kritisch genutzt werden?
Erste Pilotprojekte – etwa die AI Days an Universitäten in Deutschland und Finnland –
zeigen, dass praxisnahe Peer-Learning-Formate die wirksamste Form
des Kompetenzaufbaus sind (Fraunhofer Academy, 2025).
Gesellschaft: Digitale Mündigkeit und Vertrauen in Fakten
Auf gesellschaftlicher Ebene geht es um mehr als nur Wissenstransfer:
Der AI Mode zwingt uns, ein neues Verhältnis zu Wahrheit und Vertrauen zu entwickeln.
Studien zeigen, dass Menschen, die regelmäßig KI-Antworten nutzen,
häufiger von Confirmation Bias betroffen sind
– sie suchen nach Antworten, die ihre Meinung bestätigen
(UCL Institute for Cognitive Science, 2025).
Daher braucht es eine neue Kultur des Zweifelns:
ein Bewusstsein dafür, dass KI-Systeme plausibel,
aber nicht zwingend wahr sind.
Diese Haltung zu fördern, ist Aufgabe von Medien, Politik
und jeder einzelnen Nutzerin.
sondern bei kritischem Denken.
KI kann Wissen beschleunigen – aber nur Menschen können es bewerten.
Fazit & Ausblick
Der Google AI Mode ist mehr als ein neues Feature –
er markiert den Beginn einer neuen Ära der digitalen Informationskultur.
Zum ersten Mal in der Geschichte des Internets steht nicht mehr das
Finden von Quellen im Zentrum, sondern das
Vertrauen in generierte Antworten.
Damit verschiebt sich Macht: von vielen sichtbaren Stimmen hin zu
wenigen trainierten Modellen.
Dieser Wandel bietet Chancen: schnellere Recherchen, barrierefreie Information,
produktivere Prozesse.
Aber er birgt auch Risiken – den Verlust kritischer Distanz, die
Abhängigkeit von Blackbox-Systemen und die Gefahr, dass
KI die Vielfalt menschlicher Perspektiven nivelliert
(MIT & UCL, 2025).
In dieser neuen Landschaft wird KI-Kompetenz zum
entscheidenden Erfolgsfaktor.
Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Verwaltungen, die jetzt in
Schulung, Governance und Transparenz investieren,
schaffen die Basis für digitale Souveränität.
Denn: Der AI Mode macht uns nicht dümmer oder klüger –
er verstärkt, was wir in ihn hineinlegen.
Leitgedanke für die Zukunft:
sondern wie bewusst wir diesen Prozess gestalten.
Nur wer versteht, wie KI funktioniert, bleibt handlungsfähig,
kreativ und kritisch im digitalen Raum.
Die Verantwortung liegt bei uns allen – als Nutzer:innen,
Lehrende, Führungskräfte und Bürger:innen.
Wir müssen lernen, Fakten zu prüfen, Quellen zu hinterfragen
und Empathie nicht mit Intelligenz zu verwechseln.
Der AI Mode kann Wissen demokratisieren –
oder Desinformation perfektionieren.
Welche Zukunft wir wählen, hängt davon ab,
wie wir heute handeln, lehren und denken.
Oder wie es eine Expertin treffend formulierte:
„KI nimmt uns das Denken nicht ab.
Sie zeigt uns nur, wo wir aufgehört haben, selbst zu denken.“
Bauen Sie KI-Kompetenz auf und vertrauen Sie auf einen KI-Experten.
Quellenverzeichnis
- Ahrefs. (2025). Impact of AI Overviews on CTR. Retrieved from https://ahrefs.com/blog/google-ai-mode
- AOS Shearman. (2025). Generative AI and the EU AI Act – A Closer Look.
- Bitkom Research. (2025). KI-Kompetenzen in deutschen Unternehmen.
- Deloitte. (2025). Generative AI and Corporate Risk Management.
- European AI Board. (2025). Implementation Report on Generative AI Applications.
- European Commission. (2024). Guidelines on AI Literacy and Organisational Preparedness.
- European Parliament. (2024). EU Artificial Intelligence Act.
- European Schoolnet. (2025). Towards a Critical AI Culture in Education.
- Fraunhofer Academy. (2025). AI Literacy in der Praxis.
- Google. (2025a). Deep Search and AI Mode Overview. Retrieved from https://search.google/ways-to-search/ai-mode
- Heise. (2025). AI Mode wird zum Praxisfall für Regulierung und Governance.
- McKinsey & Company. (2025). AI Governance in European Enterprises Report 2025.
- MIT & UCL. (2025). Cognitive Offloading and Critical Reflection in AI Use.
- MIT Media Lab. (2025). How AI and Human Behaviors Shape Psychosocial Effects of Chatbot Use.
- OECD. (2025). AI Skills for Education.
- Pew Research Center. (2025). User Behavior in AI Search Environments.
- Reuters Institute. (2025). Digital News Report 2025.
- Search Engine Land. (2025). GEO vs. SEO in Generative Search Systems.
- Springer Nature. (2025). AI Content Licensing Initiative.
- TechRadar. (2025). Google adds eyes to AI Mode with new visual search features.
- University College London. (2025). The Rise of AI Companions.
- UCL Institute for Cognitive Science. (2025). Confirmation Bias in Human–AI Interaction.
- Zhou, Y., & Huang, L. (2025). Illusions of Intimacy: Emotional Attachment to Conversational Agents. arXiv preprint arXiv:2505.11649.
- Zhou, J. et al. (2025). The Attribution Crisis in Generative AI Responses. arXiv preprint arXiv:2508.00838.
FAQ – Google AI Mode, KI-Kompetenz & digitale Verantwortung
Der Google AI Mode ist ein neuer Suchmodus, der Antworten nicht mehr aus Webseiten sammelt, sondern mithilfe des KI-Modells Gemini 2.5 Pro selbst generiert. Er kombiniert Suchergebnisse, Kontext und eigene Textgenerierung zu einer zusammenhängenden Antwort – ähnlich einem Chatbot, aber direkt in der Google-Suche integriert.
Statt einer Liste mit Links erhalten Nutzer:innen eine zusammengefasste Antwort, oft mit Grafiken oder Handlungsoptionen. Das spart Zeit, reduziert aber auch das aktive Vergleichen von Quellen – und verändert, wie wir Informationen bewerten.
Weil Google-Antworten jetzt im Interface bleiben („Zero-Click Search“). Laut Ahrefs (2025) sinkt die Klickrate auf Websites um bis zu 35 %. Sichtbarkeit entsteht künftig nicht mehr über Ranking, sondern über Zitierung in KI-Antworten – ein völlig neues Spielfeld („Generative Engine Optimization“, GEO).
Verlage verlieren Reichweite und potenzielle Werbeeinnahmen, da Nutzer:innen nicht mehr auf die Originalquellen klicken. Zugleich drohen Urheberrechtskonflikte, wenn KI Inhalte nutzt, ohne sie korrekt zu kennzeichnen oder zu vergüten.
Da der AI Mode auf einem LLM basiert, fällt er unter die Kategorie „generative KI“ im EU AI Act. Das bedeutet: Transparenzpflicht, Dokumentation der Datenquellen, Bias-Kontrolle und Schulungspflicht für Nutzer:innen. Unternehmen, die KI-Ausgaben weiterverwenden, müssen diese Pflichten erfüllen.
Weil fast jede Person die Google-Suche nutzt. Damit interagiert praktisch jeder Mitarbeitende, jede Lehrkraft oder jede Behörde regelmäßig mit einem LLM. KI wird damit Teil des beruflichen Alltags – und der EU AI Act zur gelebten Praxis.
Da die KI die Auswahl und Gewichtung von Informationen übernimmt, müssen Menschen lernen, diese Ergebnisse zu hinterfragen. KI-Kompetenz heißt: zu verstehen, wie Modelle arbeiten, wo ihre Grenzen liegen, und wie man Fakten prüft, statt nur zu glauben.
Studien (MIT Media Lab, 2025; UCL, 2025) zeigen, dass Menschen emotionale Nähe zu KI-Systemen entwickeln, besonders wenn diese empathisch reagieren. Das steigert Vertrauen – aber senkt die Bereitschaft zur Faktenprüfung. KI-Kompetenz heißt daher auch emotionale Distanz wahren.
Mit drei Schritten:
1️⃣ Einführung eines AI Usage Registers zur Dokumentation von KI-Einsätzen.
2️⃣ Schulungen zu AI Literacy für alle Mitarbeitenden.
3️⃣ Etablierung einer internen KI-Governance (z. B. AI Board, Ethikrichtlinien, Audit-Verfahren).
So wird Compliance mit dem EU AI Act zur Chance statt zur Bürde.
Er verändert, wie Wissen entsteht und wem wir glauben. Wenn KI Antworten statt Optionen liefert, müssen wir stärker prüfen, reflektieren und selbst Verantwortung übernehmen. Der AI Mode zwingt uns, eine neue Kultur des Zweifelns, Lernens und kritischen Denkens zu entwickeln – als Voraussetzung für digitale Souveränität.